John Gribbin: The Climatic Threat. What's Wrong with Our Weather? (1978)
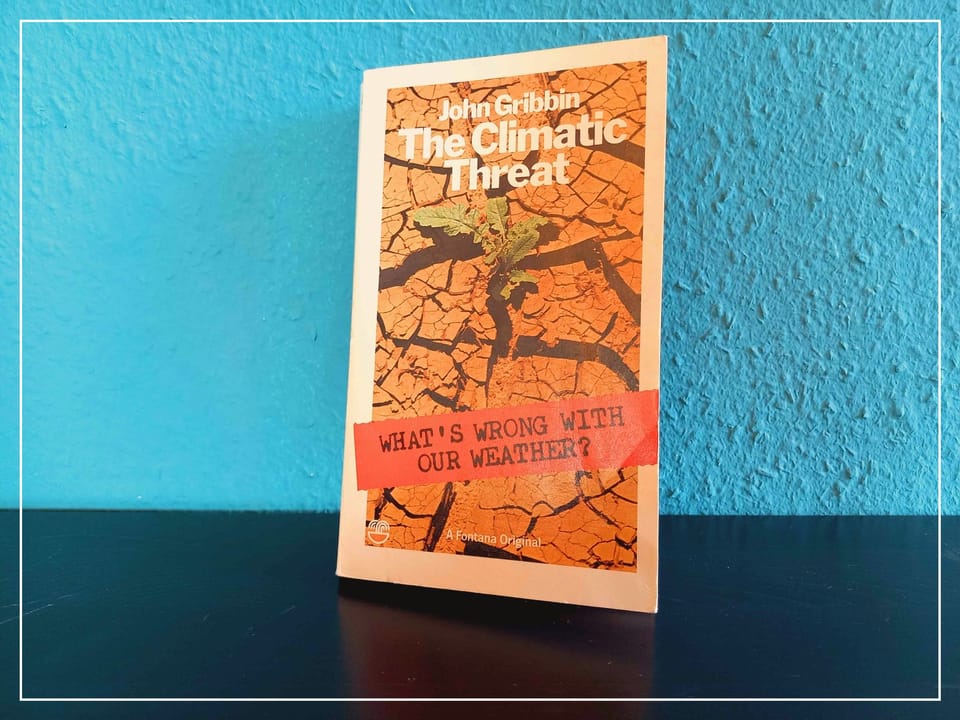
In seinem 1978 erschienenen Buch The Climatic Threat. What's Wrong with Our Weather?" diskutiert der britische Wissenschaftsautor John Gribbin (1946–) vorrangig natürliche Klimaschwankungen und mittelfristige Wettervorhersagen. Das Buch erfüllt eigentlich die Auswahlkriterien dieses Blogs nicht, da es nicht ins Deutsche übersetzt wurde und der (menschengemachte) Klimawandel nur ein Randthema ist. Ich habe die Besprechung dennoch aufgenommen, weil der Autor ein etablierter und renommierter Wissenschaftsautor geworden ist und es einen informativen Kontrast zu späteren Büchern darstellt. Es ermöglicht einen Einblick in den öffentlichen Diskussionsstand, als der anthropogene Klimawandel ganz kurz davor stand, zum gesicherten Stand der Forschung zu werden. (1979 ist eine plausible Datierung für einen ersten Durchbruch, der durch die IPCC-Berichte sukzessive gefestigt wurde, so jedenfalls Nathaniel Rich in Losing Earth (2019).) Ein Bonuspunkt für mich persönlich: Das Buch ist außerdem just ein Jahr vor meiner Geburt erschienen, so dass ich zu den zukünftigen Menschen gehöre, die Gribbin am Ende des Buches zumindest erwähnt. Der für uns interessante Inhalt ist schnell zusammengefasst: Einerseits stellt Gribbin die zentralen Fakten zum anthropogenen Klimwandel korrekt dar: Er gibt die Klimasensitivität mit 1,5 bis 3 Grad an und prognostiziert bei business as usual eine Verdopplung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre für ca. 2050. Andererseits ist Gribbin erstaunlich unbeeindruckt von dieser Einsicht und nennt sie nur als ein Faktum in einem Ozean von vielen, anscheinend mindestens ebenso wichtigen Tatsachen.
Zu den Themen, die im Hauptteil des Buchs angesprochen werden, gehören die Fragen, ob das Extremwetter 1976/77 Ausnahme oder Regel war, wann gemäß Milanković-Zyklen die nächste Eiszeit zu erwarten ist, welchen Einfluss die Sonnenaktivität auf die Erde hat und wie Aerosole das Klima beeinflussen, sei es vulkanischen oder menschlichen Ursprungs. Auch seine idiosynkratische pseudowissenschaftliche Hypothese vom Jupitereffekt, mit dem Gribbin Erdbeben vorhersagen wollte, hat Platz in dem Buch gefunden.
Diese Kapitel habe ich nur überflogen, weil sie doch arg veraltet sind. Wenn wir die Befürchtung lesen, die Extremwetterereignisse von 1976/77 – was war da eigentlich? – könnten zum neuen Normal werden, ist das nicht mehr als ein "Oh sweet summerchild!"-Moment. Auch zeitgenössische Rezensenten – Wigley (in Nature) und Hecht (im Bulletin of the American Meteorological Society) – haben das Buch nicht sonderlich freundlich aufgenommen. Beide kritisieren Gribbin sowohl für die These, die Klimavariabilität in Form von Extremwetterereignissen habe jüngst zugenommen (tatsächlich gebe es keine statistisch signifikante Erhöhung der Variabilität), als auch für die These, die Sonnenaktivität sei verantwortlich fürs Wetter (das sei alles nur Spekulation). Da man damals in Rezension noch viel, viel direkter war als heute, zwei Zitate für den academic sound of the Seventies:
"Gribbin's What's Wrong With Our Weather is a good example of a popular scientific book gone amok. It is a strange mixture of simple generalizations, half-truths, and occasional inaccuracies." (Hecht 1979: 1345)
"The book is (…) well argued and is written in an objective and authoritative manner. Unfortunately (…), this style can only deceive the 'average reader', who cannot possibly know how incompletely the author reviews the field he discusses, how uncritical and selective are his references to the scientific literature, how much he has mixed sound and well accepted work with controversial opinion and speculation and how often the cautious, tentative words of others are presented as established fact." (Wigley 1978: 788)
Den menschengemachten Klimawandel erwähnen beide Rezenten dann übrigens mit keiner Silbe.
Das ist kein Wunder: Der Klimawandel wird in Gribbins Darstellung zu einem Nachgedanken, der als Ausblick ans Ende des Buchs gestellt wird. Bemerkenswert ist bereits Gribbins Zusammenfassung des Stands der Forschung zu seiner Zeit. Gribbin sieht zwei Lager – Team Abkühlung und Team Erwärmung – einander gegenüberstehen:
"there are two strongly opposed schools of thought with a deep division between those theorists who see man’s activities hastening a global cooling — perhaps even bringing the 'next' Ice Age a few thousand years early — and those who foresee a man-made global warming" (Gribbin 1978: 173)
Dies ist deshalb so bemerkenswert, weil spätere Literaturanalysen diese angebliche Lagerbildung als Mythos zurückweisen. Die These, in den 1970er sei es seriöse Wissenschaft gewesen, eine menschengemachte Abkühlung (statt Erwärmung) zu prognostizieren, ist heute eine Legende von Klimawandelleugnern, um mit ihr die Klimawissenschaft als unzuverlässig zu diskreditieren: Laut Peterson, Connolley & Fleck 2008 sind zwischen 1965 und 1979 gerade einmal sieben Artikel erschienen, die eine Abkühlung vorhergesagt haben, darunter das notorische Paper von Rasool & Schneider (1971), von dem die Autoren sich bereits vor Gribbins Buch inhaltlich distanziert hatten.
Interessanter für uns ist aber die Gelassenheit mit der Gribbin den Klimawandel zur Kenntnis nimmt. Die Konsequenzen scheinen ihm nicht gedämmert zu haben:
"Anthropogenic influences on climate are not likely to be felt much in the remaining years of the twentieth century. But from the year 2000 onwards, these effects are likely to be of increasing importance for at least the next century, with most of man’s activities acting to produce a warmer Earth. This may, in the long term, be a good thing: a warmer Earth might be a better place to live, but there will be some severe problems of adjustment as some regions warm more than others, and as some areas receive increased rainfall while in others the rainfall declines." (1978: 181)
Gribbins Sichtweise kann man wohl so umschreiben: Die Menschheit der 70er hat viele drängende Probleme von Überbevölkerung und Hungersnöte über Energie (Ölkrise), versiegende Rohstoffe (Grenzen des Wachstums) und Umweltverschmutzung bis zur Gefahr eines Atomkriegs. Eine Erwärmung der Erde im nächsten Jahrhundert hat da keine Dringlichkeit. Was er dabei übersieht, ist, dass der menschengemachte Klimawandel sich von anderen Warmperioden (wie dem sog. Klimaoptimum der Römerzeit) durch seine Geschwindigkeit (so dass Mensch, Tier und Pflanzen sich nicht einfach anpassen können) und dem Fehlen eines natürlichen Haltepunkts (so dass wir nicht die Stop-Taste drücken können) unterscheidet. Da Gribbin an die Zukunft, also uns, delegiert, hat er auch überhaupt keinen Blick dafür, wie eine klimaneutrale Zukunft ohne fossile Brennstoffe aussehen könnte.
Was können wir aus 1978 für heute mitnehmen? Das Wichtigste zum Treibhauseffekt und menschengemachten Klimawandel war auch 1978 bereits bekannt – aber nicht in seiner Bedeutung erkannt. Würde man heute ein Buch schreiben, in dem über mehrere Kapitel hinweg der Einfluss der Sonne dargestellt wird und die menschlichen THG-Emissionen nur als Nachtrag im letzten Kapitel erwähnt wird, würde man zurecht dem Lager der Klimawandelleugner zugeordnet werden. In den 70ern war man als Wissenschaftsjournalist mit der Einstellung "Wir erhitzen vielleicht! die Erde, aber das hat vielleicht! neben schlechten, auch vielleicht! viele gute Seiten, so dass wir das Thema lieber zukünftigen Generationen überlassen" noch hinreichend im Mainstream verankert. Spoiler alert: Das ist nicht lange so geblieben.
Zum Abschluss noch der obligatorische Blick aufs Cover: Kategorie Extremwetterereignis, Unterkategorie Dürre – wir sehen eine kleine Pflanze auf einem in der Hitze verdorrtem Feld und damit ein Motiv, das wir in Variationen noch öfter sehen werden.
Quellen
- Rasool, S. Ichtiaque & Schneider, Stephen Henry (1971): "Atmospheric Carbon Dioxide and Aerosols: Effects of Large Increases on Global Climate", in: Science 173, pp. 138–141. DOI: 10.1126/science.173.3992.138
- Wigley, T.M.L. (1978), in: Nature 272, p. 788. DOI: 10.1038/272788a0.
- Hecht, Alan (1979), in: Bulletin of the American Meteorological Society 60 (1979), pp. 1345–1346. DOI: [10.1175/1520-0477-60.11.1343](https://doi.org/10.1175/1520-0477-60.11.1343
- Peterson, Thomas C., Connolley, William M., & Fleck, John (2008): "The Myth of the 1970s Global Cooling Scientific Consensus", in: Bulletin of the American Meteorological Society 89, pp 1325–1337. DOI: 10.1175/2008BAMS2370.1
- Rich, Nathaniel (2019): Losing Earth. The Decade We Could Have Stopped Climate Change. London: Picador.