Christian Schönwiese & Bernd Diekmann: Der Treibhauseffekt. Der Mensch ändert das Klima (1987)
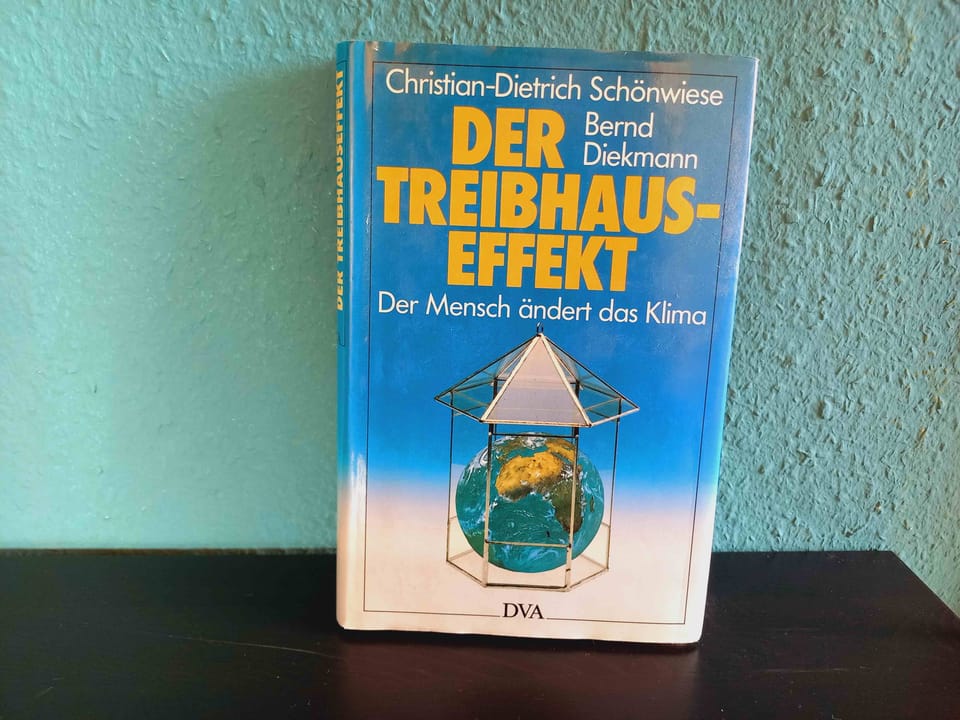
Der Klimatologe Christian-Dietrich Schönwiese (1940–), mittlerweile Emeritus an der Universität Frankfurt, spielt eine besondere Rolle in der Klimaliteratur, da gleich zwei seiner Bücher beanspruchen können, das erste deutschsprachige populäre Wissenschaftsbuch zum menschengemachten Klimawandel zu sein.
Klimaschwankungen (1979)
Schönwieses Buch Klimaschwankungen ist 1979 in der Buchreihe „Wissenschaft verständlich“ des Springer-Verlags erschienen und behandelt das titelgebende Thema sehr umfassend und nüchtern – darunter vor allem kurz-, mittel- und langfristige natürliche Schwankungen des Klimas, aber auch in einem eigenen Kapitel auf knappen 12 Seiten den menschengemachten Klimawandel.
Bemerkenswert ist ein Punkt, der aus der Rückschau gleich auf der ersten Seite des Buchs auffällt: Schönwiese beginnt das Vorwort mit einer Reihe von Fragen übers Klima und hält fest, dass diese Fragen "sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Wissenschaft immer häufiger diskutiert und immer wichtiger werden" (vii). Es steige das "Bewußtsein des Menschen, daß seine Umwelt in steigendem Maße geschädigt und in noch höherem Maße gefährdet ist" (vii). Schönwiese tritt hier nicht als ein Aufklärer auf, der Bewusstsein in der Öffentlichkeit für ein neues oder vernachlässigtes Thema schaffen will, sondern knüpft im Gegenteil an bereits bestehende öffentliche Diskussionen an. Seine Motivation entspringt mehr dem "Ärger über die immer wieder in den Medien zu findenden irreführenden oder sogar falschen Behauptungen zum Thema Klimaschwankungen" (viii). Typisch Wissenschaftler: Gefahrenbewusstsein schön und gut, aber erst einmal müssen die Fakten stimmen!
Dieser rote Faden wird sich durch die Besprechungen in diesem Blog ziehen: Kein Autor und keine Autorin tritt hier als Prometheus auf, der den Menschen eine neue, wichtige, überraschende Entdeckung bringt. Die Erklärung dafür ist nicht schwierig: Die Entdeckung des anthropogenen Klimawandels verlief im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Entdeckungen in slow motion. Von Fourier (1824) über Foote (1856), Tyndall (1859), Arrhenius (1896), Callendar (1938) und Plass (1956) und die Keeling-Kurve bis zum Charney-Report und der ersten Weltklimakonferenz (beide 1979) hatte die Menschheit in der Tat viel Zeit, sich auf die endgültige wissenschaftliche Bestätigung des anthropogenen Klimawandels vorzubereiten.
Inhaltlich weist Schönwiese (zutreffend) darauf hin, dass eine CO₂-Verdopplung bis 2040–2050 aufgrund menschlicher Aktivitäten plausibel erscheint (146) und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit einer Temperaturerhöhung von 2–3 °C einhergeht (149). Welche Folgen ein solcher Temperaturanstieg hätte, bleibt – wie schon bei Gribbin – eher vage: „Im schlimmsten Fall“ werden Köln und Hannover zu Städten an der Nordseeküste (149), aufgrund der drohenden Bevölkerungsexplosion können auch Hungerkatastrophen und Kriege nicht ausgeschlossen werden (154). Schönwieses Augenmerk liegt nicht darauf, die Folgen qualitativ (was wird geschehen?) und zeitlich (wann wird es geschehen?) konkret abzuschätzen und zu prognostizieren. Seine Warnung läuft darauf hinaus, dass wir de facto bereits massiv ins Klima eingreifen, aber überhaupt nicht verstehen, was wir da "dilettantisch" (161) anrichten.
Treibhauseffekt (1987)
Acht Jahre später, in dem Buch Der Treibhauseffekt: Der Mensch ändert das Klima (1987, zusammen mit dem Bonner Physiker Bernd Diekmann, 1950–), hat sich der thematische Fokus schon im Titel verschoben: Es geht von Anfang bis Ende um den menschengemachten Klimawandel. Noch mehr als das Buch von 1979 muss das Buch von 1987 auf vorbereitete Lesende getroffen sein: Smog, Waldsterben und Saurer Regen, Ozonloch und radioaktive Strahlung (Tschernobyl) waren nur einige der Umweltthemen in die der Klimawandel sich einreihen konnte. Das Buch scheint sich dann auch gut verkauft zu haben, wie zwei Auflagen plus eine Taschenbuchausgabe (bei Rowohlt) nahelegen.
Der Treibhauseffekt lässt den Klang der 80er wieder aufleben: Hier fahren noch Kraftfahrzeuge auf den Straßen, ist „Dritte Welt“ noch nicht verpönt, auch die BRD/DDR und die UdSSR existieren noch und Computer sind „elektronische Rechenanlagen“. Forschende haben keine Vornamen, sondern nur Initialen, die Abbildungen sind streng schematisch. Auch die Terminologie rund um den Klimawandel ist nicht die heute vertraute: Der Klimawandel ist hier noch das harmlosere „Klimaschwankung“ oder „Klimaänderung“.
Diese eher oberflächlichen Unterschiede täuschen jedoch nicht darüber hinweg, dass die Ausgangslage und die darauf aufbauenden Probleme dieselben sind wie heute: Menschen verbrennen so viele fossile Brennstoffe, dass sie die Atmosphäre merklich verändern:
„Die Folge sind weltweite Klimaänderungen, von denen wir nach den aufwendigen Klimamodell-Rechnungen annehmen müssen, daß sie in etwa zehn bis zwanzig Jahren ein größeres Ausmaß als die natürlichen Klimaschwankungen annehmen und dann offensichtlich in Erscheinung treten werden.“ (214, vgl. ausführlicher 161–163)
Diese Prognose ist spätestens 2007, also nach 20 Jahren, eingetreten: Der vierte IPCC-Bericht, die Klimakonferenz in Bali, der Friedensnobelpreis für das IPCC und Al Gore dokumentieren, dass spätestens 2007 der Klimawandel keine Prognose mehr war, sondern bereits mit eigenen Augen beobachtbar war.
Weniger greifbar sind die Vorhersagen zu den Auswirkungen des Klimawandels für die Menschen. Erörtert werden Meeresspiegelanstieg, Ernährungsknappheit und die Zunahme von Extremwetterereignissen. Dies bleibt allerdings unkonkret und in die Zukunft verlagert. Es wird den damaligen Lesenden überlassen, ob sie auf diese allgemein gehaltene Warnung mit abwartend-technophilem Optimismus ("wird schon!") oder eher mit schaurig-romantischem Weltschmerz ("ach, die Menschen!") reagieren. Dringlichkeit kommt jedenfalls kaum auf.
Dies steht im auffälligen Kontrast zu zeitgenössischen Reaktionen, die Schönwiese & Diekmann im Vorwort der Taschenbuchausgabe zitieren. Laut einer Rezension in der FAZ:
"stellen beide Autoren eine der größten Gefahren, die der Menschheit neben einem Atomkrieg drohen, schonungslos dar".
Der damalige Bundespräsident Richard von Weiszäcker schrieb ihnen sogar persönlich:
"Ihre Darstellung macht deutlicher als alles, was ich bisher gelesen habe, wie gravierend sich die Folgen unseres Verhaltens in der Zukunft auswirken werden"
In der Zwischenzeit haben wir freilich mehr und anderes als von Weiszäcker gelesen. Im Vergleich zu dem, was wir heute schon erleben und uns Mitte des 21. Jahrhunderts blüht plus all dem, was danach kommt, und selbst bei sofortigem Stop der THG-Emissionen nicht mehr verhindert werden kann, lösen die Warnungen dieses Buch so gut wie keine unmittelbare Betroffenheit aus.
Immerhin weisen Schönwiese & Diekmann die Strategie des Abwartens mehrfach als unverantwortlich zurück und empfehlen stattdessen "Weichenstellungen" (185, 215), also keine Klimaneutralität im Hauruck-Verfahren, sondern "sachliche und emotionsfreie" Lösungen "mit Augenmaß" "für unsere Kinder" (185, 215 f.). Als Handlungsfelder identifizieren sie drei Bereiche:
- Energie: Die Reduktion fossiler Energieträger sei nur durch Ausbau der Atomkraft und Energiesparen flankiert durch erneuerbare Energien zu erreichen. Die Kernfusionskonstante wird mit dem Wert 50 Jahre angesetzt statt den heute üblichen 30 Jahren (194).
- Landwirtschaft und Industrie: Die Effizienz des Energieeinsatzes müsse erhöht und die Menge von Überschuss- und Wegwerfprodukten reduziert werden, flankiert durch Wasserstoff in der Stahlproduktion und andere technische Innovationen.
- Bevölkerungspolitik: Dieses ökologische "Kernproblem" (208) müsse begegnet werden durch Zugang zu Empfängnisverhütung, Bildung für Frauen und Einsicht bei religiösen Führern, überkommene Wertvorstellungen neu zu interpretieren.
Auf die gesellschaftlich-politisch-ökonomische Umsetzung wird nicht im Detail eingegangen, aber Schönwiese & Diekmann erwähnen immerhin:
- die Notwendigkeit staatlicher Richtlinien für die Transformation, heute würde man wohl sagen: forward guidance (204 f.),
- eine Primärenergie-, Rohstoffeinsatz- und Abfall-Steuer als Ersatz für die Mehrwertsteuer (207), die aber nur lose an die CO₂-Steuer erinnert, da die Steuerlast nicht strikt an THG-Emissionen geknüpft wird,
- die Abwesenheit eines Finanzierungsproblems, wie die immensen weltweiten Ausgaben für Rüstung zeigten – Geld ist genug da (190, 217, 220), und
- die nötige gesellschaftliche "Einsicht in die Notwendigkeit der Maßnahmen" (207), wobei hier sowohl die individuellen Bürger:innen (bottom-up) als auch die Entscheidungsträger:innen in Wirtschaft und Politik (top-down) angesprochen werden sollen.
Das ist alles wohlfeil, wenn auch die Risiken der Kernenergie und der Reboundeffekt (hinstlich Energiersparen) unterschätzt und das Problem Bevölkerungswachstum überschätzt wird. Auffällig sind weniger die Punkte, in denen Schönwiese & Diekmann den heutigen Klimadiskurs vorwegnehmen, sondern die Punkte, die im heutigen Diskurs Standard sind und bei Schönwiese & Diekmann fehlen: Heute ist es ein Topos der Klimaliteratur, dass Klimaschutz im Kern kein technisches Problem (mehr) ist, sondern eine Frage des Wollens und Umsetzens. Verbunden wird dies mit der positiven Vision einer grünen Zukunft, in der wir unabhängig von autokratischen Energielieferanten werden, Arbeitszeit reduzieren, Wegwerfprodukte abschaffen, Umweltverschmutzung reduzieren usw. Diese Überzeugung und diese Vision fehlen Schönwiese & Diekmann. Dementsprechend unfreiwillig (?) abschreckend und düster fallen manche ihre Einschätzungen aus:
"Wir müssen in vielerlei Hinsicht von überkommenen Wertvorstellungen Abschied nehmen, wenn wir den Planeten, auf dem wir leben, nicht ruinieren wollen. Was den Treibhauseffekt betrifft, haben wir nachdrücklich auf die Möglichkeiten zur Abhilfe hingewiesen: Geburtenkontrolle, Abschied von der Doktrin des Wirtschaftswachstums, Einschränkung des Lebensstandards und besonders der Abbau des Überflusses in den Industrieländern." (215)
Mit diesem harschen Programm leisten sie der Klimapolitik einen Bärendienst. Die Forderungen von Fridays for Future und der Letzten Generation, die teilweise als apokalyptische Weltuntergangssekten diskreditiert wurden, sind harmlos dagegen. Das scheint mir symptomatisch für die 80er: Einerseits traut man sich noch, kompromisslos zu denken: Abschied von Wirtschaftswachstum, Einschränkung des Lebensstandards, Verzicht auf Überfluss, Kritik am Komfort- und Anspruchsdenken. Andererseits fehlt die politische Perspektive: Auf die Frage, wie das denn politisch um- und durchgesetzt werden soll, wird mit einem klischeetriefendem Lamento bestehend aus Politik-, Medien- und Bürger:innen-Schelte begegnet. Die Politik denke nicht langfristig, sondern nur von Wahlperiode zu Wahlperiode, die Medien berichten nur Katastrophenmeldungen und verstehen wissenschaftliche Unsicherheiten nicht, die Bürger:innen reagieren nicht auf schleichende Katastrophen und sind einem Komfort- und Anspruchsdenken verfallen.
Wo soll man bloß anfangen, um auf diese zutreffenden wie kurzsichtigen Beobachtungen zu antworten? Wer an gesellschaftliche Fragen mit der Erwartung rangeht, man müsse nur sachlich und objektiv über die Fakten berichten und schon würden die richtigen Weichen gestellt werden, wird tatsächlich in der Politik nur Enttäuschungen erleben. Man kann dies zum Anlass neben, sich beleidigt zurückzuziehen, oder die Einsicht mitnehmen, dass dies den Kern des Politischen ausmacht: Einsichten entstehen nicht durch Expertenmitteilung, sondern durch erlebte Erfahrungen, charismatische Vermittler und manchmal erst nach der x-ten Wiederholung. Interessen müssen artikuliert und gegen Widerstände durchgesetzt werden. Mehrheiten müssen organisiert werden, manchmal durch Schulterschlüsse mit anderen, bei denen man nie zusammenlaufende Interessen vermutet hätte. Dann kann man sich auch mal mit Menschen politisch verbünden, die Angst vor dem Ozon"loch" und Hautkrebs haben und muss sie nicht wie Schönwiese für ihre "Ozon-Psychose" zurechtweisen (1979: 151, vgl. 1987: 108).
Schönwiese & Diekmann kommt das Verdienst zu, sich frühzeitig mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Klimawandel an die Öffentlichkeit gewandt zu haben. Spätere Autor:innen haben den Vorteil, dass der Klimawandel mess- und erlebbar ist, während Schönwiese & Diekmann noch in der Situation waren vor einem Spiel mit dem Feuer zu warnen, von dem man noch nicht so genau sagen konnte, wie viel und wann auf dem Spiel steht. Das Buch belegt dabei eindrücklich und erneut, dass im Großen und Ganzen das Wissen 1987 vorhanden war, um die von Schönwiese & Diekmann geforderten "Weichenstellungen" zu rechtfertigen. Nun sind diese Weichen aber nicht oder viel zu spät gestellt worden. Das Modell von Wissenschaftskommunikation und Politik, für das Schönwiese & Diekmanns Buch ein Beispiel ist, ist jedenfalls gescheitert. Das heißt jedoch nicht, dass wir mit fast 40 Jahren Abstand wüssten, was 1987 ein besserer Ansatz anders gemacht hätte.
Zum Abschluss noch der obligatorische Blick aufs Cover: Kategorie Erde aus dem Weltall, Unterkategorie mit Zusatz – wir sehen unseren blauen Planeten in einem sechseckigen, pavillonartigen Treibhaus.
Quellen
- Schönwiese, Christian-Dietrich (1979): Klimaschwankungen. (= Verständliche Wissenschaft) Berlin: Springer.
- Schönwiese, Christian-Dietrich & Diekmann, Bernd (1987): Der Treibhauseffekt. Der Mensch ändert das Klima. Stuttgart: DVA.
Der Treibhauseffekt (1987) war nicht Schönwieses letzte Station als Autor populärer Klimabücher, sondern ist das erste von gleich vier Büchern in weniger als zehn Jahren: 1992 erschien im gleichen Verlag der Nachfolger Klima im Wandel: Tatsachen, Irrtümer, Risiken, das auch eine Taschenbuchausgabe bei Rowohlt erhielt. 1994 erschien Klima: Grundlagen, Änderungen, menschliche Eingriffe in der Reihe „Meyers Forum“. 1995 folgte noch eine Überarbeitung des Buchs von 1979 unter dem neuen Titel Klimaänderungen: Daten, Analysen, Prognosen bei Springer. Soweit ich es beim Durchblättern beurteilen konnte, überlappen sich diese Bücher inhaltlich sehr. Erst nach einer längeren Pause folgte 2019 mit Klimawandel kompakt: Ein globales Problem wissenschaftlich erklärt Schönwieses bisher letzter Aufschlag. Über seinen Ko-Autoren Diekmann dagegen ist nicht viel herauszufinden: Er hat als Experte für Energiephysik weitergearbeitet, ist aber anscheinend nicht mehr publizistisch zum Klimawandel in Erscheinung getreten.